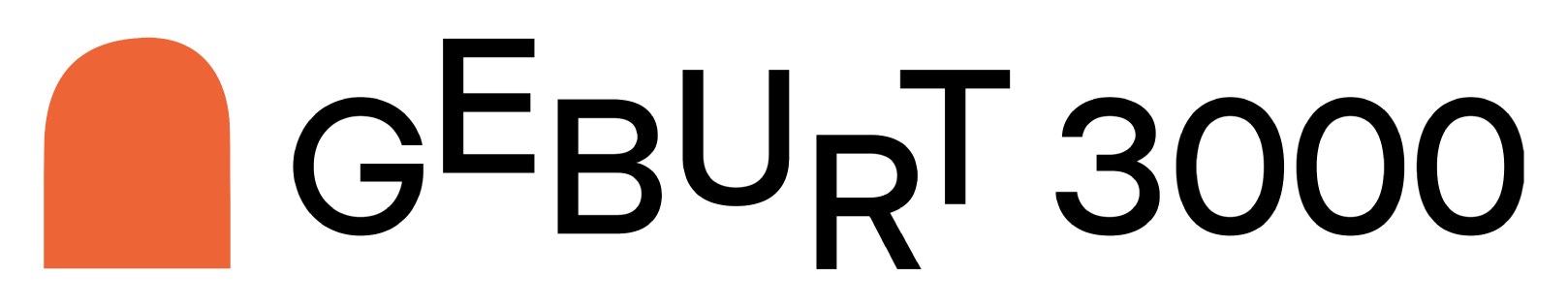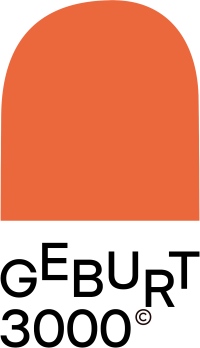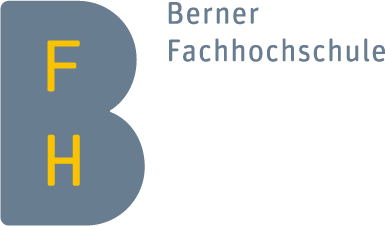Unsere
Ansätze
Die Herausforderungen. Unsere Lösungsansätze
Kooperation statt Konkurrenz
Die Herausforderung
Die Versorgungsmodelle klinischer und ausserklinischer Geburten werden in der Schweiz und im gesamten deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten separat voneinander gedacht und entwickelt. Das Resultat: Ausserklinische Geburten fristen ein Nischendasein, obwohl sie durch ihre frauenzentrierte Arbeitsweise den individuellen Bedürfnissen der Gebärenden entsprechen.
Unser Ansatz
Geburt 3000 entwickelt gemeinsam mit den Spitälern ein Versorgungsmodell, das ausserklinische und klinische Geburtshilfe zusammendenkt. Durch die enge Zusammenarbeit ermöglichen wir das gemeinsame Lernen voneinander und verringern Konkurrenzdenken – Resultat: echte Wahlfreiheit ohne Angst vor Unterversorgung für Gebärende.
Modulare heilende Architektur
Die Herausforderung
Neu gebaute Geburtsräume sind oft ein kleiner Teil innerhalb riesiger Neubauprojekte von grossen Spitalkomplexen. Dabei werden die Bedürfnisse von Gebärenden während der Geburt kaum berücksichtigt. Oft wird auf altbekannte und in der Branche übliche Lösungen zurückgegriffen, ohne neue Erkenntnisse der «healing architecture» beim Bau zu beachten.
Unser Ansatz
Geburt 3000 plant den Geburtspavillon so modular, nutzungsoptimiert und gesundheitsfördernd wie möglich. Die Elemente des Pavillons sind einfach erweiter- und austauschbar. Durch das Baukastenprinzip lassen sich die Pavillons kostengünstig an unterschiedlichste Bedingungen und Anforderungen anpassen und effizient herstellen.
Der andere Geburtsort
Die Herausforderung
Die Konkurrenzsituation zwischen der inner- und ausserklinischen Geburtshilfe zwingt werdende Mütter zur Entscheidung: höchste Sicherheit, durch interventionistische Geburtshilfe oder ein möglichst natürlicher, individueller und interventionsarmer Geburtsprozess. Geographisch sind Geburtshäuser in der Schweiz zudem nicht für alle Frauen leicht zugänglich und die Anreise kann bis zu einer Stunde betragen. Sie entscheiden sich in der Regel für das naheliegende Spital. Hinzu kommt, dass aufgrund verschiedener individueller Exklusions- und Diskriminierungsverfahren viele Gebärende ausserklinische Versorgungsmodelle gar nicht kennen und somit nicht in Anspruch nehmen.
Unser Ansatz
Durch die Nähe des Geburtspavillons zum Kooperationsspital wird zum einen das Sicherheitsbedürfnis der Frauen erfüllt. Viele Frauen empfinden Spitäler als den Ort, an dem sie im Falle von Komplikationen die notwendige medizinische Versorgung erhalten können. Zum anderen wird die Erreichbarkeit von Geburtshäusern begünstigt – und damit schliesslich die Wahlfreiheit vieler Frauen in der Schweiz verbessert. Ausserdem hat es sich Geburt 3000 zum Ziel gesetzt, ein geschlechter-, kultur- und traumasensibler Raum für Frauen und Familien zu entwickeln.
Lehren und Lernen
Die Herausforderung
Die Datenlage rund um ausserklinische Geburten und der Einfluss von Raum und Architektur auf Geburten ist im Vergleich zur klassischen klinischen Geburtshilfe verschwindend gering. Ausserklinischer Geburtshilfe fehlt es an einer wissenschaftlich fundierten Argumentationsbasis, um den Diskurs rund um die Entwicklung, Etablierung und Modifizierung zukunftsfähiger Versorgungsmodelle mitzugestalten.
Unser Ansatz
Geburt 3000 arbeitet eng mit der Berner Fachhochschule zusammen, um Gelerntes zu evaluieren und zu validieren. Wir setzen damit von Beginn an grossen Wert auf Qualitätssicherung und schaffen eine wissenschaftliche Grundlage für zukünftige Projekte und Forschung. Zugleich wird mit der Entwicklung eines CAS «Hebammengeleitete Geburtshilfe» die Fachkompetenz diplomierter Hebammen gefördert und gestärkt.
Attraktiv für Fachkräfte
Die Herausforderung
Steigende Burn-Out-Zahlen, die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie und fehlende Weiterbildungsperspektiven sind Ursachen für einen aktuell hohen Fachkräftemangel im Hebammenberuf. Ausserklinische und klinische Hebammenteams treten ausserdem bisher kaum in Kontakt und verstärken somit Konkurrenzdenken unter Hebammen.
Unser Ansatz
Geburt 3000 setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz der zeitgenössischen Geburtshilfe, bei dem die Arbeitsbedingungen der Hebammen eine wichtige Rolle spielen. Unsere Hebammenteams arbeiten generationsübergreifend, in flachen Hierarchien und autark. Lebenslanges Lernen und die enge Zusammenarbeit mit den Teams in den Spitälern sind Kernbestandteile unseres Betriebsmodells.